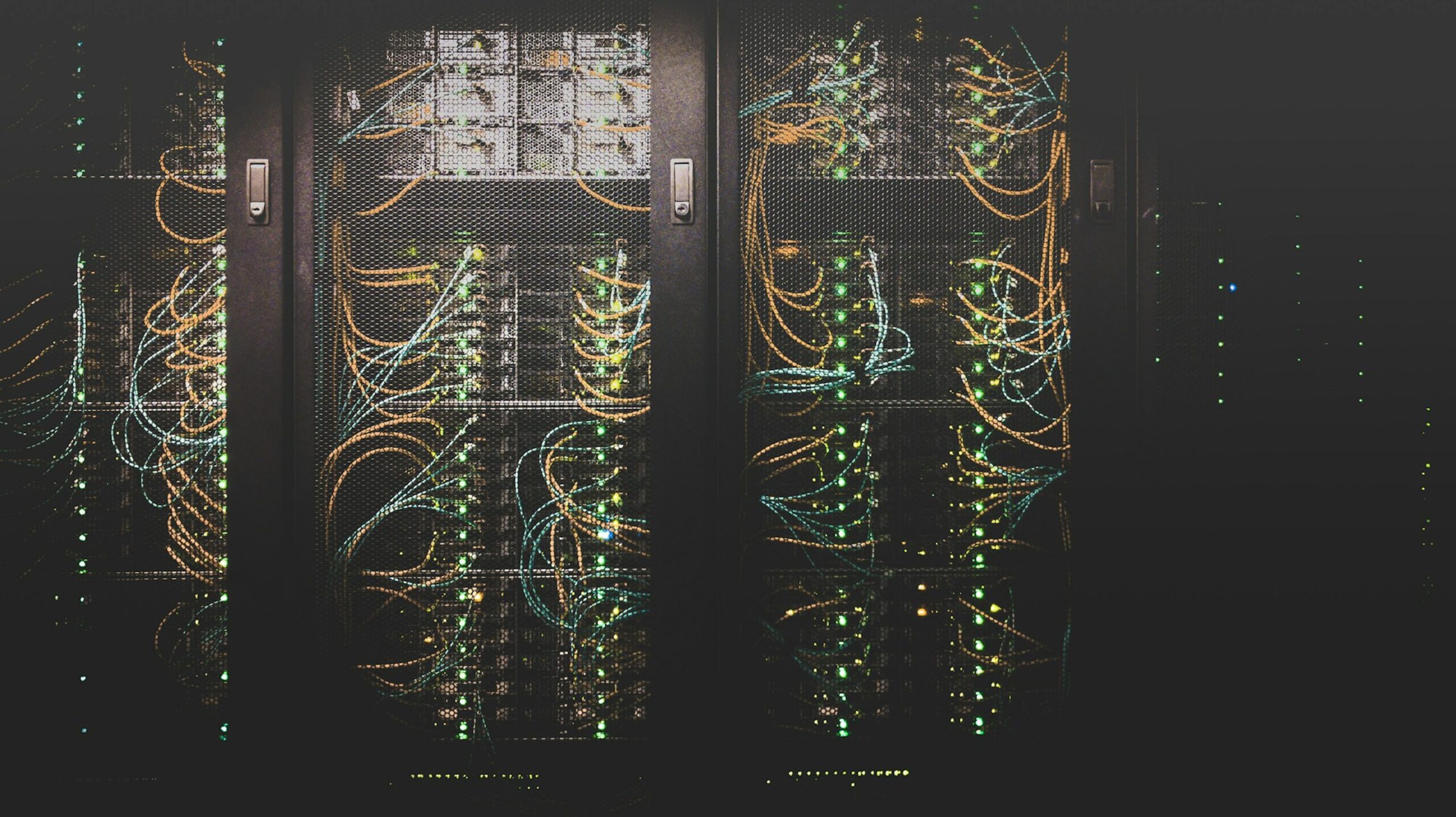
KI – Offenheit versus Black Box
Anfang der 1990er-Jahre begann der finnische Student Linus Torvalds ein kleines, beinahe unscheinbares Experiment: Er wollte ein freies Betriebssystem – die digitale Grundarchitektur jedes Computers – schaffen, das jede und jeder kostenlos nutzen, verändern und weitergeben darf. Dazu veröffentlichte er den Code im Internet und lud andere ein, mitzuwirken. Dieser Schritt war revolutionär. Weltweit begannen Menschen, beizutragen, zu testen und zu verbessern – freiwillig, gemeinschaftlich und offen. So entstand Linux: Ein Betriebssystem, das niemandem und doch allen gehört.
Diese radikale Offenheit wurde zum Erfolgsrezept. Unternehmen, Universitäten und Behörden griffen Linux auf, weil sie den Code verstehen, prüfen und anpassen konnten. Heute läuft Linux auf den meisten Servern, Supercomputern und Handys, auf Autos, Fernsehern und Raumsonden. Es steht für Transparenz, Zusammenarbeit und digitale Selbstbestimmung – und für eine Kultur, in der Wissen geteilt statt monopolisiert wird.
Ohne Transparenz keine demokratische Kontrolle
Drei Jahrzehnte später stehen wir an einem ähnlichen Wendepunkt – diesmal mit grossen Sprachmodellen (LLMs). Diese Systeme verstehen, schreiben und übersetzen Texte und prägen zunehmend unsere Kommunikation und Entscheidungen. Doch im Gegensatz zu Linux sind die meisten Modelle weitgehend geschlossen: Ihre Funktionsweise, Trainingsdaten und Entscheidungsmechanismen bleiben verborgen. Dabei ist Offenheit hier noch wichtiger. In geschlossenen LLMs können kulturelle Verzerrungen, Urheberrechtsverletzungen oder kommerzielle Interessen verdeckt und tief eingebaut sein. Hier bestehen enorme Risiken, besonders wenn sie in Bildung, Verwaltung oder Justiz zum Einsatz kommen. Ohne Transparenz fehlt die Grundlage für das nötige Vertrauen und die demokratische Kontrolle der Systeme.
Hier setzt die Schweiz ein starkes Zeichen. Mit dem Supercomputer ALPS am CSCS in Lugano verfügt sie über eine der leistungsfähigsten und energieeffizientesten Recheninfrastrukturen der Welt. Darauf aufbauend haben die technischen Hochschulen im Tessin mit Apertus ein offenes Sprachmodell geschaffen – transparent, nachvollziehbar und gemeinschaftlich weiter entwickelbar. Das Modell kann schon in der ersten Version bestens mit den ganz grossen und bereits etablierten Systemen mithalten. Apertus zeigt, dass KI souverän und gemeinwohlorientiert entstehen kann – unabhängig von den Datensilos und der Profitmaximierung grosser Tech-Konzerne.
Unbedingt in Bildung und Forschung investieren
Ein offenes LLM wie Apertus ist mehr als ein technisches Werkzeug – es ist eine öffentliche Infrastruktur des digitalen Zeitalters. Gelingt es, eine lebendige Gemeinschaft rund um Apertus aufzubauen, kann die Schweiz etwas Einzigartiges schaffen: das Linux der Sprachmodelle – offen, überprüfbar und demokratisch kontrollierbar.
Politik und Verwaltung müssen jetzt handeln, indem sie die strategische Bedeutung solcher offenen Systeme anerkennen, sie finanziell und institutionell fördern und in der öffentlichen Beschaffung bevorzugen. Und statt Mittel für Bildung und Forschung zu kürzen, wie das der Bundesrat und die rechte Ratsmehrheit vorhaben, muss die Schweiz gezielt in Wissen, Offenheit und digitale Souveränität investieren. Nur so werden wir Innovation, Vertrauen und die Förderung des Gemeinwohls im KI-Zeitalter sicherstellen.
Hinweis: Dieser Text ist als Parldigi-Kolumne auf Inside-IT erschienen

